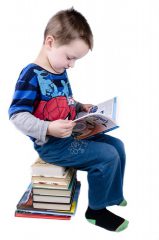
Die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern kommt vor allem erwerbstätigen Müttern zu Gute. Foto: pixabay.com
Die Bedeutung verlässlicher Ganztagsbetreuung für die Müttererwerbstätigkeit hat mit dem 2013 formulierten Anspruch auf einen Kitaplatz für die unter Dreijährigen längst Eingang in die Familienpolitik gefunden. Neue Studien fordern nun vergleichbare familien- und bildungspolitische Maßnahmen zum Abbau der bestehenden Betreuungslücken im Grundschulalter ein.
Eine neue Auswertung des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) zeigt, dass die Möglichkeit, Erstklässler_innen in Ganztagsschulen oder Horten betreuen zu lassen, die Erwerbsbeteiligung von Müttern wesentlich beeinflusst. Analysiert wurden Familien, bei denen mindestens ein Kind im Zeitraum von 1999 bis 2013 von der Kita in die Grundschule gewechselt ist.
Die Auswertung ergab, dass sich die Wahrscheinlichkeit, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, durch die nachmittägliche Betreuung der Grundschulkinder signifikant erhöht, und zwar um 7,5 Prozentpunkte. Mütter, die vor dem Schuleintritt ihres Kindes nicht erwerbstätig waren, sind mit einer um 11,4 Prozentpunkte höheren Wahrscheinlichkeit nach der Einschulung ihres Kindes erwerbstätig, wenn dieses nachmittags eine Ganztagsschule oder einen Hort besucht. Mehr als elf Prozent der Mütter, die vor der Einschulung ihres Kindes nicht berufstätig waren, stiegen wieder in ihren Beruf ein, weil ihre Kinder auch nachmittags betreut werden konnten.
Für bereits erwerbstätige Mütter zeigt sich ebenfalls ein Anstieg in der Wahrscheinlichkeit, weiterhin erwerbstätig zu sein (um 5,4 Prozentpunkte), auch wenn dieser Zusammenhang weniger stark ausgeprägt ist als für die Gruppe der nicht erwerbstätigen Mütter. Mütter, die bereits zuvor einem Job nachgingen, weiteten ihre Arbeitszeit außerdem um durchschnittlich zweieinhalb Stunden pro Woche aus.
Darüber hinaus untersuchten die Wissenschaftler_innen, ob eine institutionalisierte Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder das Arbeitsvolumen von Vätern beeinflusst. Die Daten bestätigen die Vermutung, dass nach wie vor nicht die Väter, sondern die Mütter ihre Arbeitszeiten entlang der Betreuungsbedarfe der Kinder ausrichten. Ein Zusammenhang zwischen Betreuungsangebot und Erwerbsumfang ließ sich für die Väter trotz wachsenden Zuspruchs zu einem partnerschaftlichen Modell der Arbeitsteilung in Beruf und Familie nicht feststellen.
Studienergebnisse und Statistiken finden Sie hier.












